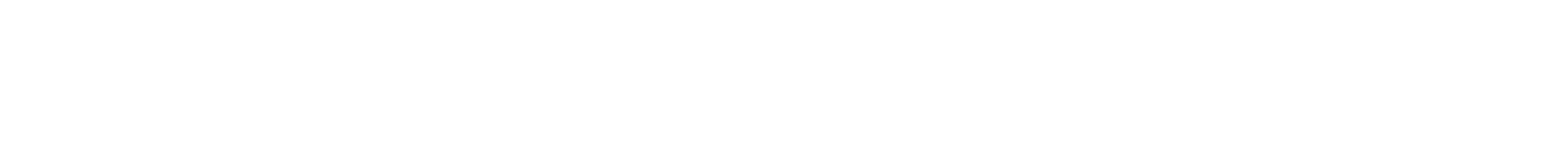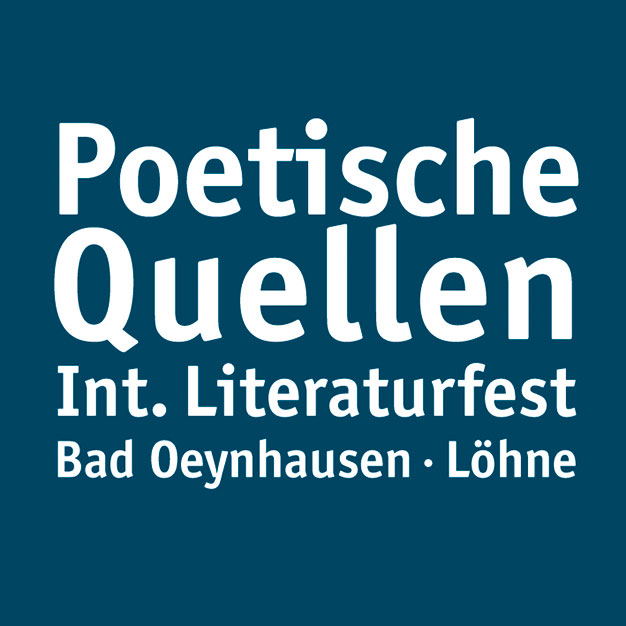DAS SONNTAGSGESPRÄCH – FORUM FÜR DEMOKRATIE
[Sonntag, 31.08.2025 / Beginn: 11.30 Uhr]
»Von der Deutung zur Vermessung der Wirklichkeit – Über Bildung,
Demokratie und Menschlichkeit in Zeiten von KI«
Gäste: Roberto Simanowski, Claudia Hamm und Martin Burckhardt
Moderation: Jürgen Keimer
»Es wäre katastrophal, würden wir zu einer Nation von technologisch kompetenten Menschen verkommen, die die Fähigkeit verloren haben, kritisch zu denken, sich selbst zu hinterfragen und die Menschlichkeit und Vielfalt der anderen zu achten.«
[Martha Nussbaum, Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education, 1997]
»Die Bewegungsfreiheit wird zunehmend eingeschränkt, das Leben zu Funktion und Instrument. Der Plan ist alles, die Individualität nichts. Wo aber die Ersetzbarkeit des einzelnen so weit vorangetrieben wird, beherrscht die Abstraktion das Feld und hat mit der Durchfunktionalisierung des einzelnen die Misanthropie leichtes Spiel.«
[Helmuth Plessner, Über Menschenverachtung, 1953]
»Hundert Jahre lang versuchen wir nun schon, Maschinen für die Menschen arbeiten zu lassen und die Menschen für einen lebenslangen Dienst an ihnen zu schulen. Es stellt sich jetzt heraus, dass Maschinen nicht machen, was wir wollen und dass man Menschen nicht auf ein Leben im Dienste von Maschinen abrichten kann. Wir müssen Abschied nehmen von der Hypothese, auf der das Experiment beruhte. Diese Hypothese besagte, dass die Sklaverei mit Hilfe von Maschinen abgeschafft werden kann. Es hat sich gezeigt, dass die Maschinen die Menschen versklaven, wenn sie zu diesem Zweck eingesetzt werden.«
[Ivan Illich, Selbstbegrenzung. Eine politische Kritik der Technik, 1975]
»Ich meine dabei mit Barbarei etwas ganz Einfaches, dass nämlich im Zustand der höchstentwickelten technischen Zivilisation die Menschen in einer merkwürdig ungeformten Weise hinter ihrer eigenen Zivilisation zurückgeblieben sind – nicht nur, dass sie in ihrer überwältigenden Mehrheit nicht die Formung erfahren haben, die dem Begriff der Zivilisation entspricht, sondern dass sie erfüllt sind von einem primitiven Angriffswillen, einem primitiven Hass …«
[Theodor W. Adorno, Erziehung zur Mündigkeit, 1971]
Welche Perspektiven haben freiheitlich-liberal organisierte Gesellschaften in einer ausgeprägt digital-medial gelenkten und übererregten Gegenwart heutzutage noch, um auf Spannungen, Gefahren und Krisen zu reagieren, die ihren Einfluss immer gravierender auf demokratisch organisierte Gemeinwesen ausüben.
Neben dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, dem Klimawandel und dem sich ausweitenden kriegerischen Konflikt im Nahen Osten gehört zu diesen Krisen ebenso der Vertrauensverlust gegenüber politisch handelnden Personen und gegenüber den öffentlich-rechtlichen Informationsmedien. Die Gefahr, dass Demokratien in einen Autoritarismus abrutschen nimmt nicht zuletzt durch eine gesamtgesellschaftliche Tendenz zur populistischen, undifferenzierten Vereinfachung innerhalb der Kommunikation, durch das Vertauschen von Virtualität mit Realität sowie durch das Ersetzen von Empathie durch Funktionalität immer weiter zu.
Vor diesem beunruhigenden Szenario, aus dessen Blickwinkel Zukunft gerade auch aus Sicht jüngerer Generationen nur mehr dystopisch betrachtet wird, wäre es dringend notwendig, sich ausführlich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie vor allem wieder Bildung mit geschichtlicher Erkenntnis und ohne Entwurzelung kultureller Herkünfte und Traditionen in die Lage versetzt werden kann, den Menschen in einer Weise zu prägen, damit er, ausgestattet mit Urteilsfähigkeit und Wissen, sich seiner Menschlichkeit wieder gewiss werden kann, um mit einer frisch gewonnenen Mündigkeit das Leben in Gemeinsamkeiten auf eine neue, aufgeklärte und auch wieder positive Grundlage stellen zu können, die sich öffnet auf eine bejahende Zukunft.
Dazu gehört die unentbehrliche Auseinandersetzung mit der wichtigen Frage, inwiefern diese Grundlage entweder immer weiter durch den Einfluss der sogenannten „Künstlichen Intelligenz“ und einer Maschine wie ChatGPT ethisch ausgehöhlt wird oder umgekehrt sogar einen Ausgangspunkt dafür darstellen kann, um ein neues, noch gar nicht absehbares Bild vom Menschen und damit auch von einer Gesellschaft zu entwerfen, die hoffentlich nie dazu bereit sein wird, sich ihre Entscheidungen und ihre Freiheit von der rein utilitaristischen Ethik einer Vermessungstechnik abnehmen zu lassen, die über das Einfordern von Transparenz vor allem Kontrolle und Überwachung generiert.